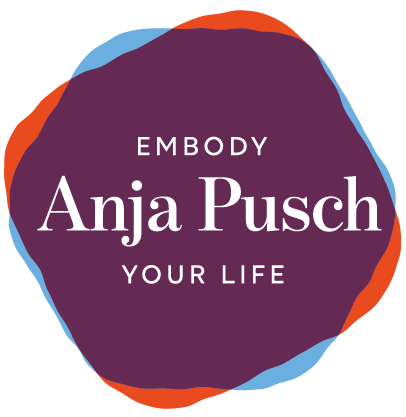Ich lese ja sehr viel. Sehr, sehr viel. (Zur Zeit übrigens einen unglaublichen Roman, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow / Morgen und morgen und morgen von Gabrielle Zevin. Wenn Ihr dieses Jahr nur einen Roman lest, dann bitte diesen!)
Und weil das Lesen und die Literatur so ein wichtiger Teil meines Lebens ist, ergänze ich meine therapeutischen Sitzungen oft mit Buchhinweisen – das sind selten die klassischen Ratgeber- oder Selbsthilfebücher (à la Liebe Dich selbst und es ist egal, wen Du heiratest – auch wenn das ein tolles Buch ist), meistens sind es Bücher mit Hintergrundinformationen zu bestimmten Themen, oft philosophische, essayartige (z. B. von Daniel Schreiber), und sehr oft ist es Belletristik. Das mache ich nicht in jeder Sitzung, bei jeder Klientin und auch nicht systematisch mit einer Liste, aus der ich auswähle, sondern genau dann, wenn ich eine Idee habe und es passt – zur Situation, zum Klienten und zum Prozess. Und natürlich, wenn der Klient eine Buchempfehlung hören will. Eine Klientin sagte sogar mal: „Sie haben echt für jedes Problem ein Buch!“ Äh, ja. Ratgeber empfehle ich übrigens deshalb nicht, weil sie uns Leser meistens voll motivieren mit den Inhalten, und hinterher fühlt man sich noch schlechter, weil man die Umsetzung nicht hinkriegt.
Tatsächlich gibt es sogar eine eigene Therapieform, die „Bibliotherapie“ (aka Lesetherapie oder Buchtherapie) heißt. Literatur wird genutzt, um Menschen bei der Bewältigung von Problemen, der Verarbeitung von Emotionen und der Förderung ihres psychischen Wohlbefindens zu unterstützen. Sie kann sowohl begleitend zu anderen Therapien eingesetzt werden als auch als eigenständige Methode. Und somit setze ich die Bibliotherapie ergänzend zu meinen therapeutischen Methoden ein, und finde, das passt sehr gut zur systemischen, hypnosystemischen und zur körperorientierten Therapie.
Und wie und warum wirkt das Lesen eigentlich so gut?
Grund 1:
Das Lesen von Büchern und anderen literarischen Texten kann heilende und transformative Kräfte haben. Dabei geht es nicht nur um das reine Lesen, sondern auch um die Auseinandersetzung mit den Texten, die Identifikation mit Figuren oder Situationen, das Erkennen von eigenen Problemen und das Finden von Lösungswegen.
Grund 2:
Leser können sich oft nicht nur mit den Protagonisten identifizieren, sondern sogar ein Gefühl der Verbundenheit und des Verständnisses für die eigenen Erfahrungen entwickeln – Selbstmitgefühl also. Mir selbst geht es u. a. bei den Büchern von Julia Schoch so.
Grund 3:
Das Lesen kann „kathartisch“ wirken – Emotionen wie Angst, Trauer oder Wut können freigesetzt und verarbeitet werden. Wer kennt das nicht – das Mitleiden, Mitbangen, Weinen – und das nicht Zu-Ende-Lesen-Wollen? Mir geht es gerade eben so bei Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow.
Grund 4:
Das Lesen kann zu neuen Perspektiven und Erkenntnissen über sich selbst und die eigene Situation und die Situation der Umwelt führen. Ein schönes Beispiel ist bestimmt Arno Geigers Der alte König in seinem Exil.
Grund 5:
Leser erkennen, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind und dass andere Menschen ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Daniel Schreiber schafft das in seinen nicht sehr langen und gleichzeitig sehr intensiven Büchern meisterhaft, z. B. wenn er über Einsamkeit, Trauer oder Alkohol schreibt.
Grund 6:
Man fühlt sich „gesehen“ von der Art und Weise, wie eine Autorin oder ein Autor über ein Thema schreibt. Das muss noch nicht einmal der Inhalt sein, sondern die ganz spezifische Wahrnehmung und Art der Wiedergabe dieser Wahrnehmung. Zuletzt ging es mir bei Marleene Streeruwitz‘ Auflösungen so, und auch bei zu liebenvon Ulrike Draesner.
Fazit: Lesen! Lesen! Lesen!
Meine gesammelten Sachbuchempfehlungen findet Ihr unter https://anja-pusch.de/blog/buchempfehlungen/.
Aktuelle Buchtipps veröffentliche ich immer in meinem Newsletter: https://www.cantienica-mannheim.de/newsletter
Alle meine gelesenen Bücher findet Ihr auf Goodreads. Gerne folgen!